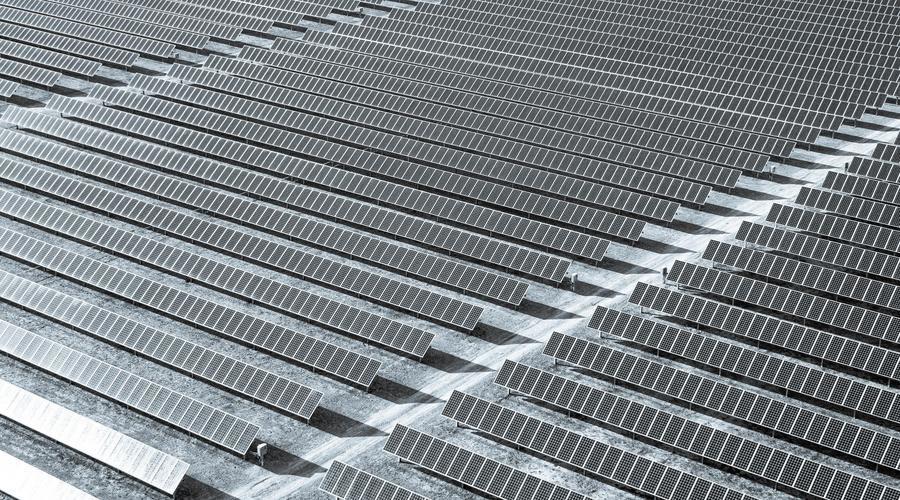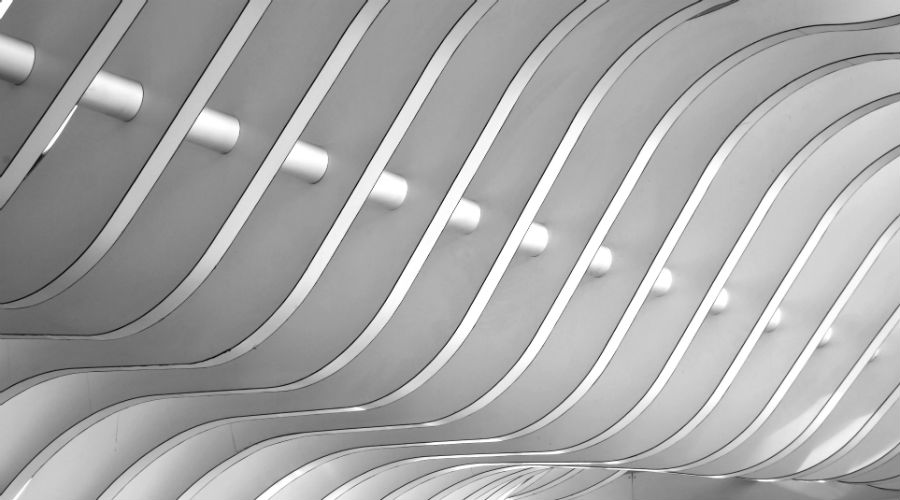1. Hintergrund des Festlegungsverfahrens
Das Verfahren HEDWIG (Az. 4.17.04) verfolgt das Ziel, die gesetzlichen Transparenzpflichten nach dem Energiewirtschaftsgesetz umzusetzen. Am 11. August 2025 veröffentlichte die BNetzA ein Eckpunktepapier, das die Eckdaten des Prozesses, die betroffenen Marktteilnehmer und den organisatorischen Ablauf beschreibt. Die Stellungnahmefrist läuft bis zum 22. September 2025; am 25. August 2025 fand hierzu ein Expertenworkshop statt.
2. Ziele von HEDWIG
Das Festlegungsverfahren HEDWIG verfolgt mehrere, eng miteinander verknüpfte Ziele. Im Mittelpunkt steht die Umsetzung der Vorgaben des EnWG, insbesondere die in § 1 EnWG formulierten Grundsätze einer sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten, umweltverträglichen und treibhausgasneutralen Energieversorgung (S. 5). Durch die zentrale Erhebung und Veröffentlichung von Energiemarktdaten sollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Energiemarkt erheblich gesteigert werden (S. 5). Zugleich dient das Verfahren der Unterstützung der Energiewende, indem es aktuelle und belastbare Daten zu Erzeugung, Verbrauch, Speicherung, Transport, Handel und Vertrieb von Strom, Gas und Wasserstoff bereitstellt (S. 5 – 6). Die BNetzA verfolgt damit das Ziel, sowohl den beteiligten Marktakteuren als auch der interessierten Öffentlichkeit fundierte Informationen an die Hand zu geben, um eine sachliche Diskussion über die Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen (S. 5). Darüber hinaus soll die Datenbasis eine effizientere Marktüberwachung ermöglichen und anderen Behörden für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zur Verfügung stehen (S. 6). Ein weiteres Ziel ist die Optimierung der Datenerhebung selbst: die Verbesserung von Datenqualität und -granularität, die Vermeidung von Doppelmeldungen sowie die Umsetzung des Prinzips der Datensparsamkeit (S. 6).
3. Adressatenkreis
Nach Vorstellung der Bundesnetzagentur sollen die Meldepflichten im Rahmen von HEDWIG vor allem jene Akteure erfassen, die maßgeblich zur Transparenz und Funktionsfähigkeit des Energiemarktes beitragen. Dazu zählen in erster Linie Energieversorgungsunternehmen, Marktgebietsverantwortliche sowie Betreiber größerer Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als einem Megawatt (S. 6). Auch Börsenbetreiber wie die European Energy Exchange (EEX) oder EPEX SPOT werden ausdrücklich in den Adressatenkreis einbezogen (S. 6). Nach den Überlegungen der Behörde sollen zudem auch Betreiber kleinerer Anlagen im Bereich zwischen 100 kW und 1 MW bestimmte Daten übermitteln, insbesondere dann, wenn es um Nichtverfügbarkeiten oder andere relevante Ereignisse geht (S. 7).
Darüber hinaus verfolgt die BNetzA die Idee, sogenannte zentrale Stellen noch stärker einzubinden. Hierzu gehören insbesondere die Übertragungsnetzbetreiber, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sowie weitere Organisationen, die bereits heute Daten bündeln und weitergeben (S. 7). Auf diese Weise soll eine einheitliche und effiziente Datenstruktur geschaffen werden, die einerseits die Qualität und Vergleichbarkeit der Informationen verbessert und andererseits die Marktakteure entlastet. Insbesondere soll durch die Bündelung verhindert werden, dass identische Informationen mehrfach erhoben werden müssen, während gleichzeitig eine Standardisierung der Meldeprozesse gewährleistet wird (S. 7).
4. Inhalte und Datenerhebung
Das Eckpunktepapier der BNetzA beschreibt die geplanten Inhalte der Datenerhebung im Detail. Erfasst werden sollen Daten zu Strom, Gas und Wasserstoff, wobei für jede Kategorie eine präzise Definition der Datenarten, der Erhebungsmethodik sowie der verwendeten Begriffe vorgesehen ist (S. 8). Darüber hinaus sieht die Festlegung die Verwendung standardisierter Datenformate vor, insbesondere die Nutzung des JSON-Formats, um eine automatisierte und effiziente Verarbeitung zu ermöglichen (S. 8). Neben aktuellen Daten sollen auch historische Daten erhoben werden, um Entwicklungen und Trends im Energiemarkt systematisch analysieren zu können (S. 8).
Besondere Aufmerksamkeit legt die BNetzA auf den Umgang mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Marktakteure müssen diese sensiblen Daten ausdrücklich kennzeichnen; erfolgt keine Kennzeichnung, gelten die Daten als zur Veröffentlichung freigegeben. Eine Veröffentlichung erfolgt grundsätzlich aggregiert oder zeitlich verzögert, sodass Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen ausgeschlossen werden. Personenbezogene Daten werden nicht veröffentlicht (S. 8).
Die technische Umsetzung der Datenerhebung soll über einen von der BNetzA betriebenen Data Hub erfolgen. Dieser stellt eine Schnittstelle für die automatisierte und kontinuierliche Meldung von Daten bereit und sieht die Identifikation der Datenlieferanten über ELSTER-Organisationszertifikate vor (S. 9). Darüber hinaus ist vorgesehen, dass zentrale Stellen Aufgaben übernehmen und dadurch die primären Meldepflichtigen entlasten (S. 9). Die Datensicherheit wird durch die Nutzung einer BSI C5:2020-zertifizierten Cloud-Infrastruktur im europäischen Wirtschaftsraum gewährleistet. Sämtliche Daten werden während der Übertragung sowie im Ruhezustand verschlüsselt (S. 9). Für den Fall, dass Marktakteure ihren Meldepflichten nicht fristgerecht nachkommen, sieht die BNetzA ein gestuftes Sanktionssystem vor: Zunächst erfolgt eine Benachrichtigung, sodann besteht die Möglichkeit einer Nachmeldung, im Wiederholungsfall drohen jedoch Zwangsgelder oder Bußgelder (S. 9).
5. Ausblick
Da es sich bislang lediglich um ein Eckpunktepapier handelt, hat die Bundesnetzagentur noch keinen förmlichen Festlegungsentwurf vorgelegt. Das Eckpunktepapier dient in der Verfahrenslogik der BNetzA zunächst dazu, die zentralen Zielsetzungen, Inhalte und den geplanten Ablauf transparent zu machen und den Marktteilnehmern die Möglichkeit zur frühzeitigen Stellungnahme zu geben. Nach Berücksichtigung der Konsultationsbeiträge wird die BNetzA einen Festlegungsentwurf veröffentlichen und eine weitere Konsultation starten, was voraussichtlich im dritten Quartal 2025 erfolgen wird. Diese zweite Konsultationsphase soll etwa im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Die Finalisierung der Festlegung ist nach derzeitigem Zeitplan für das erste Quartal 2026 vorgesehen.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie aktuell die Möglichkeit haben, aktiv Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung zu nehmen, bevor rechtlich verbindliche Regelungen erarbeitet werden.
6. Unser Angebot
Als auf Energierecht und regulatorische Fragestellungen spezialisiertes Team können wir Sie im Rahmen des HEDWIG-Verfahrens unterstützen und begleiten, ihre Pflichten frühzeitig zu erfassen, Stellungnahmen fundiert auszugestalten und interne Abläufe an die künftigen Anforderungen anzupassen.
Weiterführende Links